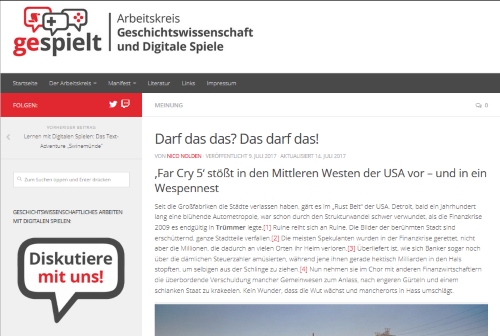‚Kingdom Come: Deliverance‘ ist zum DCP nominiert – das sorgt für Kritik aus der Geschichtswissenschaft
Schon vor der Veröffentlichung des Action-Rollenspieles ->Kingdom Come: Deliverance im Frühjahr 2018 entzündete sich Kritik an Äußerungen des Lead Designers Daniel Vavrá und dem damit verbundenen Geschichtsbild. Jan Heinemann fasste in seinem Blog die international erhobenen Vorwürfe zusammen und warf der Spielepresse vor, die soziokulturelle Relevanz des darin gezeigten Mittelalterbildes nicht zu erkennen (->Das „authentischste Historienspiel aller Zeiten?!, in: Let’s Play History vom 13.1.2018). Die Entwickler des Spieles – ein durchaus technisch und spielmechanisch beeindruckendes Ergebnis – versprachen ein authentisches spätmittelalterliches Böhmen um das Jahr 1403. Frei von Magie und Drachen hatten sie ihre Mühe, internationale Publisher zu finden und nahmen die Dinge schließlich mit einer Kickstarter-Kampagne selbst in die Hand (siehe ->NEWS: Good Fight! Good Knight! vom 13.2.2014). Damit war ihnen ein grandioser Erfolg beschieden, allerdings wirft – bei aller Begeisterung für das Spiel selbst – die historische Inszenierung einige Fragen auf.
Das Actionrollenspiel ist beeindruckend inszeniert, leider ist sein Bild vom Spätmittelalter tendenziös rechtskonservativ („Kingdom Come: Deliverance – Launch Trailer [DE]“, in: Kanal Deep Silver vom 12.2.2018 via Youtube)
Im vergangenen Jahr hielt ich mich mit Kommentaren zurück, auch nachdem Heinemann das Spiel so heftig kritisiert hatte. Allerdings erhob er weniger die Vorwürfe selbst, als dass er sie aus einer international schwelenden Diskussion vor dem Release zusammenfasste. Im Kern ging es um die Darstellungen von Geschlechtern und alles Fremden, die auf eine rechtskonservative Gesinnung mit Folgen für das Mittelalterbild hinweisen. Das gewählte Szenario deutet daher auch nicht ohne Grund auf den Gründungsmythos der tschechischen Nation. Leider konnten ich und auch viele Kritiker bis zu diesem Zeitpunkt die Spielwelt noch selbst gar nicht betreten haben. Seit ich dieses Blog 2009 gründete, bin ich jedoch immer nach der Devise verfahren, mich bei Stellungnahmen zu Spielen zu bremsen, die ich nicht selbst substantiell gespielt habe. Viele Interviewanfragen aus der Zeit musste ich daher ablehnen, selbst wenn mich die Aufmerksamkeit für mein Blog gefreut hätte.
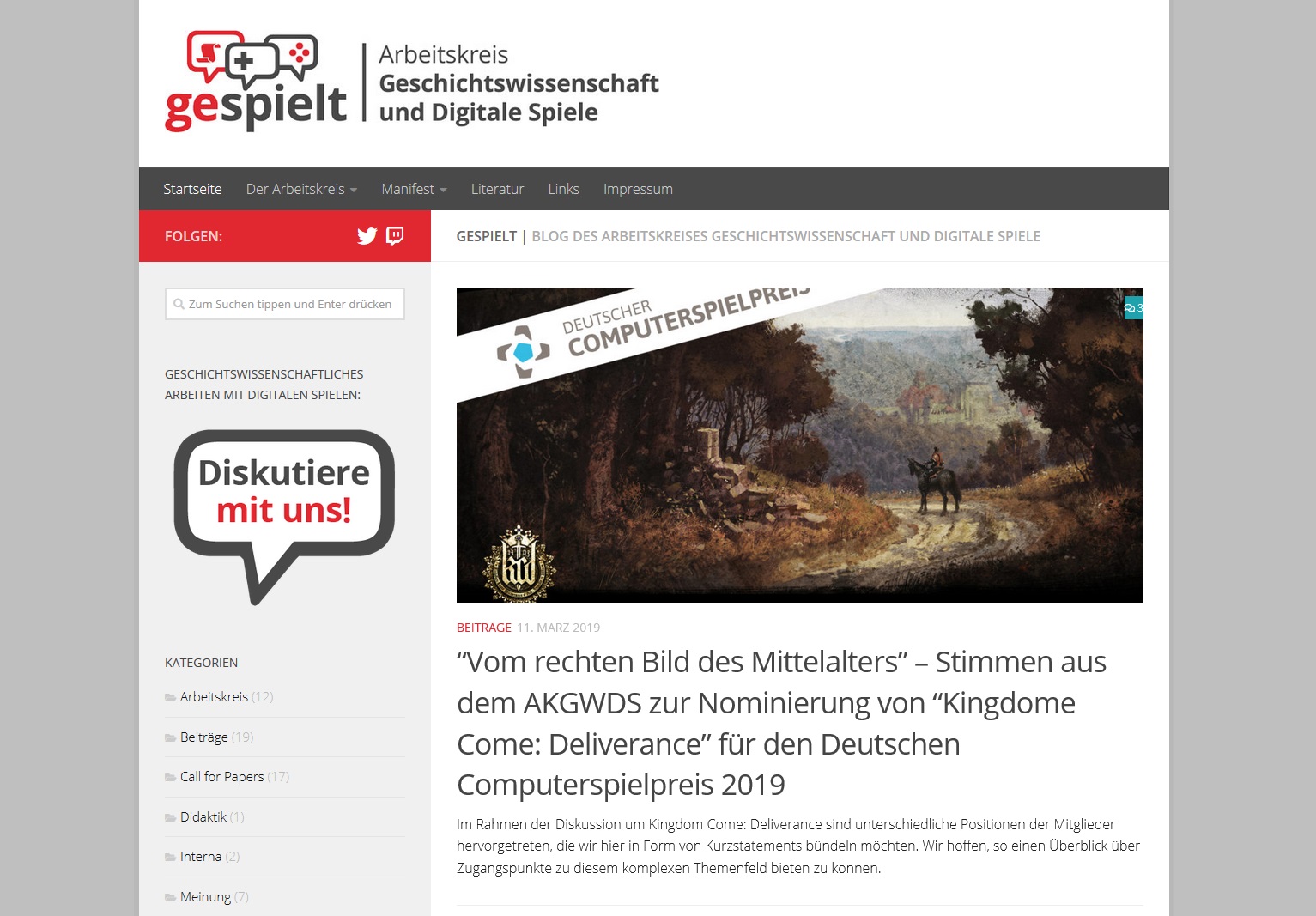
Nun, ein Jahr später, hatte ich in unserem ->GameLab der ->Public History Hamburg auch die Gelegenheit, ->Kingdom Come: Deliverance zu spielen. Im Blog ->gespielt des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und digitale Spiele (AKGWDS) nehm ich daher zusammen mit einigen Historikerinnen und Historikern zu dem spätmittelalterlichen Rollenspiel Stellung: -> „Vom rechten Bild des Mittelalters“ – Stimmen aus dem AKGSDS zur Nominiereung von „Kingdom Come Deliverance“ für den Deutschen Computerspielpreis 2019, in: gespielt vom 11.3.2019). Es beteiligten sich Felix Zimmermann, Jan Heinemann, Eugen Pfister, Aurelia Brandenburg und Robert Heinze. Es freut mich, dass auch ich Gelegenheit bekam, meinen Beitrag dazu zu leisten.
Der Anlass für den neuaufgelegten, kritischen Diskurs ist, dass die Jurys des ->Deutschen Computerspielpreis 2019 das Mittelalter-Rollenspiel in der Kategorie „Beste Spielwelt“ nominierten. Offenbar ist es für die beteiligten Personen aus Politik und Gesellschaft, Spielejournalismus und Games-Branche vorstellbar, dass Kingdom Come trotz der rechtsnationalen Gesinnung seines Geschichtsbildes einen dotierten Prestigepreis gewinnen darf. Um die Stimmen der Geschichtswissenschaft in diesem Diskurs noch einmal laut werden zu lassen, entschlossen wir uns, die verschiedenen Positionen der Mitglieder einzubringen. Bewusst haben wir uns dort als Personen und nicht als Verband mit unseren Meinungen positioniert. Zentrale Punkte gleichen sich zwar, aber die Ansichten über das Spiel unterscheiden sich doch in interessanten Details. Beteiligen Sie sich dort gern an der Diskussion.
*