Teil 4 – Netzwerk-Knoten
Schon lange hatte ich geplant, dem Spielejournalismus in seinen verschiedenen Formen, einen umfassenden Beitrag zu widmen. Der Artikel sollte vor allem die gegenwärtige Lage der Redakteure und TV-Produzenten kommentieren – mit einem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. In jüngster Zeit brechen sich nun zahlreiche Entwicklungen Bahn, welche dem Spielejournalismus rasant ein neues Gesicht verleihen. Es ist höchste Zeit, dass mein Blog in einen Rundumschlag den gegenwärtigen Status zusammenfasst. Angesichts der Vielzahl von Veränderungen konnte dieser Überblick nur sehr lang werden. Daher erscheinen im Abstand von wenigen Tagen mehrere Blogbeiträge zu verschiedenen Facetten. Die Serie schließt mit einer Bewertung der jüngsten Veränderungen und einem ebenso vorsichtigen wie gewagten Ausblick.
Teil 2 – Altlast des Objektivismus
Teil 3 – Der digitale Tsunami
Teil 4 – Netzwerk-Knoten
Teil 5 – Die Youtubisierung des Abendlandes
Teil 6 – Ein vorsichtiger Ausblick (folgt)
Geflecht
Nachdem der digitale Tsunami durch die journalistische Landschaft gefegt war, hinterließ er eine wachsende Zahl an ehemaligen Redakteuren, die nun als Honorarkräfte frei am Markt konkurrierten. Das waren keineswegs Einzelfälle, sondern eine Vielzahl von talentierten Menschen. Der Arbeitsmarkt wurde recht schnell eisig, weil so viele entlassene Talente in freier Konkurrenz die Preise verdarben – und wohl noch immer verderben. Als damals beispielsweise eine massive Kündigungswelle durch das Hamburger Verlagshaus ->Gruner+Jahr schlug, bewarben sich langjährige, ehemalige Journalisten als Praktikanten auf ihre ehemaligen Stellen – das war nicht nur ein unwürdiger Umgang, sondern veränderte auch nachhaltig die Qualität der Magazine.

Auf der anderen Seite entstanden aus der Asche des Arbeitsmarktes nun Netzwerke von Personen, die sich unabhängig von Strukturen wie Verlagen zu eigenen webbasierten Projekten zusammenschlossen. Dort probierten sie sich mit neuen Formaten und Themen aus. Natürlich schlugen sich diese Netzwerke auch institutionell nieder, zum Beispiel im Autoren-Netzwerk von Zeitschriften, die auf professionelle Akteure aus der Games-Branche zurückgreifen. Diese setzen Honorarkräfte gelegentlich auch sinnvoll als Spezialisten ein, weil sie als Gastautoren aus verschiedenen Feldern nahe an bestimmten Facherfahrungen stehen – im Zweifel hat man sich jedoch dafür mit einer sperrigen Schreibe zu arrangieren.
Die Entlohnung aber sinkt immer weiter, so dass die freien Spielejournalisten ums Überleben kämpfen; so wie die noch fest angestellten Redakteure bangen, ebenfalls freigesetzt zu werden. Für die Seite der Journalisten ist dies ein bedauernswerter Zustand, der sich jedoch nicht ändern wird, solange sich keine tragfähigen Wertschöpfungsideen entwickeln. Aus Kundensicht aber entstand durch die kreativen Geister im Web eine pulsierende, lebendige Szene, die mit immer neuen Ideen und Themen ein spannendes, informelles Netzwerk für die Spielekultur bilden. Dieser Teil lenkt daher den Fokus einmal auf diese Netzwerke…
Spielmacher
Als Erscheinungsformen solcher fachlicher Netzwerke haben sich alte und neue Magazine erwiesen. Sie etablierten institutionelle Plattformen, die sich immer tiefer in die Business-Landschaft einschrieben. So ist das Autoren-Netz der ->Gamestar in der europäischen wie auch der internationalen Spielewelt pures Gold wert. Merklich wird das zum Beispiel, weil Autoren es mithilfe des Renommée eines solchen Magazins leichter fällt, namhafte Figuren der Branche zu speziellen Anliegen zu interviewen. Das dürfte nicht jedem Blog-Betreiber gelingen. Für diesen Expertenruf verantwortlich ist neben der beständigen Marke des Magazins auch die sehr erfolgreiche ->making games, eine Zeitschrift von der Branche für die Branche. Deren Beiträge verfassen häufig Entwickler und Publisher, jedoch auch Spieleredakteure. Allerdings hat sich bei dem Magazin eine wichtige Veränderung eingestellt, deren mögliche Folgen noch thematisiert werden.

Diese Branchen-Institution wurde 2005 unter dem Namen /gamestar/dev/ geboren, zunächst verantwortet von Gunnar Lott und Andre Horn (siehe ->/gamestar/dev/ – IDG launcht Magazin für Spieleentwickler, in: Gamestar.de vom 15.7.2005). Vor allem aber wurde das Magazin von Heiko Klinge mit Leidenschaft und Energie fortentwickelt. Das Projekt sollte helfen, jenseits von dem Wanderzirkus sporadischer Fachkonferenzen einen regelmäßigen, ortsunabhängigen Austausch der Entwickler und Produzenten über digitale Spiele, ihre Produktion und ihr Umfeld zu fördern. Zaghaft wagte man sich im Gründungsjahr an vierteljährliche Ausgaben. Langjährige Akteure der Branche dokumentieren in dem Magazin ihre Erfahrung und geben sie weiter. Neue Ideen und Impulse setzen Startups, Praktiker und Ausbilder, Forscher etwa aus Medienwissenschaft, Ökonomie und Psychologie oder auch Künstler und Designer. Zudem gibt ein Serviceteil Tipps in Rechtsfragen oder stellt Lösungen in der Programmierung vor. Damit geht die ->making games auch über den Branchenteil der britischen ->Edge hinaus (siehe Teil 3 – Der digitale Tsunami)
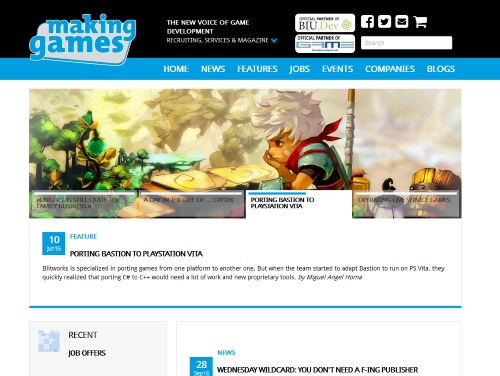
In mehr als zehn Jahren hat das Magazin, das mittlerweile 6 Mal im Jahr erscheint, seinen Themen- und Leserkreis erheblich internationalisiert. Waren die Beiträge und ihre Schöpfer vorher eher deutschsprachig und regional, tragen heute englischsprachige Artikel und renommierte Gastschreiber mehr internationale Relevanz in die Ausgaben. Bisher gelang es den Herausgebern dennoch recht gut, auch eine spezielle mitteleuropäische Sicht auf die Dinge zu bewahren – nur sind auch solche Beiträge häufiger auf englisch und nicht mehr deutsch. In der extrem transnationalen Gemeinde der Spieleentwickler und -produzenten wird jedoch englisch als Umgangssprache ohnehin überall vorausgesetzt.
Im Laufe der Jahre baute der Verlag auch sein Webangebot aus, richtete einen Stellenmarkt sowie einen Newsstream ein und animierte Entwickler zu eigenen Blogs in der hauseigenen Farm. Mit der Jobmesse ->making games Talents, die 2016 zum Beispiel in Berlin stattfand, führte sie die Branche mit den ausbildenden Standorten in Deutschland zusammen. Ich würde sagen, das dies kein geringer Verdienst in einem Land ist, das ausgerechnet in diesem Hochtechnologiebereich noch immer meint, weitgehend auf staatlich organisierte Ausbildungsgänge verzichten zu können. Jaja, „Neuland“, schon klar.
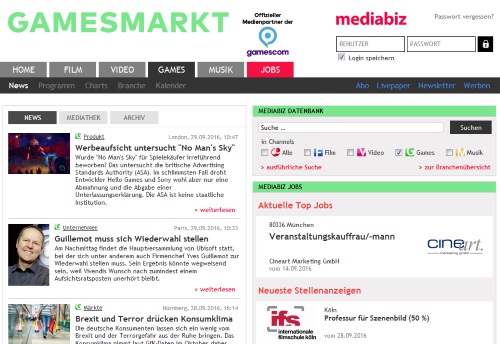
Mit dem Konzept und der Nähe zur ->Gamestar, dem Leitmagazin der deutschsprachigen Spieleszene, grub die ->making games ihrem Hauptkonkurrenten ->GamesMarkt zunehmend das Wasser ab. Dieses Magazin, das bis 2014 Teil des Hamburger Verlages ->Gruner+Jahr war, konzentrierte sich stärker auf die Business-Aspekte der Spieleentwicklung, steuerte damit jedoch zur Spielekultur eine andere Perspektive bei und lieferte zudem handfeste Daten. Nach dem Wechsel aller Anteile zum Verleger Busch unterzog sich der Mitbewerber einen Makeover und startete Anfang 2016 einen Relaunch. Ob der Versuch von Erfolg gekrönt wird, bleibt abzuwarten.
Im Juni dieses Jahres startete zudem das reine Web-Portal ->gameswirtschaft.de als neue Konkurrenz. Das von ->Petra Fröhlich federführend repräsentierte Portal für Informationen aus der Games-Branche hat sich als umfassendes Nachrichtenmagazin zwar mit soliden Sachinformationen gut eingeführt, verfällt aber häufig in reißerische Tabloid-Schlagzeilen. Etwas übertrieben erschien mir etwa jüngst der Totengesang auf die Free-To-Play-Akteure in Deutschland. Da bleibt die ->making games deutlich sachlicher, unaufgeregter und differenzierter. Energisch widersprach dem Abgesang auch der Gründer des Hamburger Studios ->Bytro Labs in einer Kolumne bei ->gameswirtschaft.de (siehe ->Felix Faber: Browsergames? Denen geht es super, danke der Nachfrage, in: gameswirtschaft.de vom 28.9.2016). Man könnte sagen, es entwickelt sich da eine Art ->Focus Online für die Games-Branche. Solange dort fundierter recherchiert wird als bei dem Magazin, das einstmals als Spiegelkonkurrent angetreten war, soll mir diese neue Stimme am Markt recht sein.
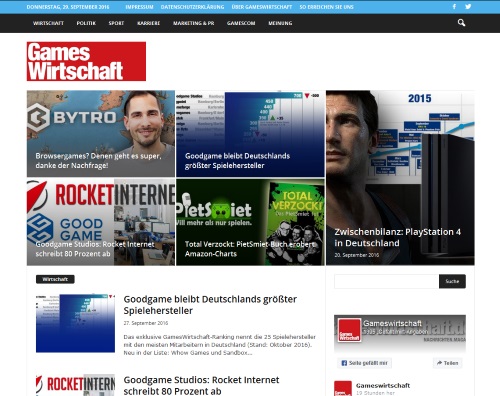
Das Spektrum der Branchenmagazine stark verschieben könnte nun der recht plötzliche Verkauf von ->making games an den ->Computec Verlag anfang 2016. Damit gehen die ->Gamestar und das Branchenmagazin getrennte Wege. Auf mögliche Auswirkungen dieser Zäsur komme ich im Ausblick zurück, zuvor aber muss ich zu deren Verständnis erst die anderen Teile dieser Artikelreihe ausführen.
Reputation ist Macht
Die ->making games war zumindest bisher ein wichtiges Verbindungsglied zwischen der Spielekultur und den Produzenten von digitalen Spielen. Ihre Leserschaft reicht weit über den deutschsprachigen Raum hinaus, weshalb man ihre Relevanz keinesfalls unterschätzen darf: auch wenn Deutschland als Produzentenland wenig Einfluss hat, aufseiten des Konsums liegt hier einer der wichtigsten Märkte weltweit. Alle Hersteller legen da gerne früh ihr Ohr auf das Gleis, um zu hören, was kommt. ->Gamestar und ->making games sind da wichtige Horchhilfen.
Für die Branche sind die Urteile von Magazinen sogar so wichtig geworden, dass manche Publisher sogar die Höhe der Vergütung ihrer Studios von dem Wertungsschnitt auf ->Metacritic abhängig machen (siehe ->Schreier, Jason: Why Are Game Developer Bonuses Based On Review Scores, in: Kotaku vom 15.3.2012). Kaufen Magazine und Webseiten mehr und mehr Beiträge von Freien Redakteuren hinzu und leisten sich – nach meiner Einschätzung – den Luxus kleiner Redaktionen, so werden eben solche Wertungen schwerer kalkulierbar. Das Renommee einer so zusammengestrichenen Redaktion sinkt und schlägt sich auf das Profil ihrer Marke nieder.
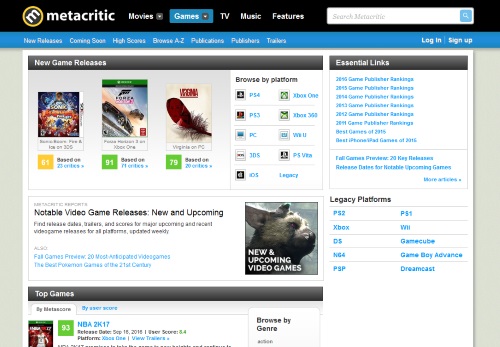
Andererseits steigt so das Renommee von zentralen Autoren. Deren individuelle Eignung ist im Zweifel aber schwerer zu überblicken, als wenn man auf ein bekanntes Redakteursteam und die Marke von dessen Zeitschrift vertrauen kann. Die seit einigen Jahren zunehmende Praxis schadet also der Verlässlichkeit von Wertungsgrundlagen, und damit den Entwicklern, weil ihre Einkünfte davon direkt wegen der Boni via ->Metacritic oder indirekt wegen der Kaufentscheidungen potentieller Kunden abhängen.
Hintergrundrauschen
Wenn man an externen Sachverstand denkt, also Experten aus der Wissenschaft etwa oder Praktiker mit Erfahrungen aus der Games-Entwicklung, müssen Freie Autoren nicht per se schlecht sein. Sie liefern Impulse aus ihren Arbeitsgebieten als Spezialisten, die Redakteure nur mit extrem aufwändigen Recherchen selbst aufbereiten könnten. Schwierig wird es da, wo das Alltagsgeschäft einer Redaktion zunehmend an Externe übertragen wird. Ansonsten sind Honorarkräfte kein grundsätzliches Übel.
Im Portfolio der ->Gamestar befindet sich geradezu ein Heer von Ex-Mitarbeitern und anderen erfahrenen Beiträgern, die über enormes Hintergrundwissen aus jahrelanger Tätigkeit in der Branche verfügen. Ihr Know-How, die Bekanntheit ihrer Namen und treue Fans halten sie nahe an den Epizentren der Branche. Sie schufen ein Hintergrundrauschen, eine breite Szene aus Nachfolgeprojekten – jenseits von den Institutionen der Magazine. Darunter sind PodCasts, also abrufbare Sendungen ähnlich eines Radiotalks, Streaming-Angebote etwa via ->Twitch und Kanäle bei ->Youtube.
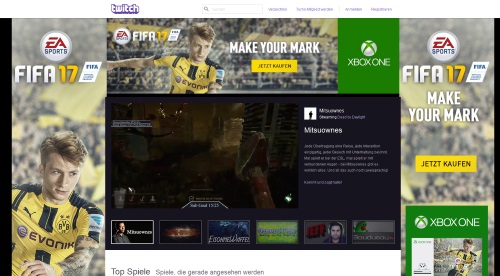
Formate gibt es dabei in allen Medienkategorien, ob nun als Bewegbild, Text oder Ton. Seit seinem Abschied beim Magazin gibt sich ->Fabian Siegismund in seinem Projekt ->BattleBros. nebenberuflich seiner Leidenschaft, der ->Battlefield-Reihe, hin. Der ehemalige Chefredakteur ->Jörg Langer betreibt mit ->Gamers Global ein Textportal für eine erwachsene Perspektive auf digitale Spiele. Neben seiner Medienagentur trägt ->Benedikt Plass-Fleßenkemper auf der Seite ->spielejournalist.de – wie er sagt – die textlichen Gourmet-Stücke eines großen Autorennetzwerkes zusammen.
Auch im Audiobereich gibt es viel zu entdecken. Ein weiterer ehemaliger Redaktionschef der ->Gamestar, ->Gunnar Lott, im Netz auch bekannt als ->Herr Kaliban, diskutiert sehr hörenswert mit dem erwähnten Christan Schmidt im Podcast ->Stay Forever Themen der Branche und der Spielkultur aus mehreren Jahrzehnten. Und ->André Peschke, der 2016 der ->Gamestar seinen Rücken zukehrte, verweilt jetzt regelmäßig mit einem weiteren Alumni ->Auf ein Bier, dem oben schon genannten Jochen Gebauer, unterhält sich dabei über Games und stellt das ganze als ->PodCast ins Netz (hier via Soundcloud). Übrigens beschäftigten sich beide in ihrem ersten Beitrag 2015 auch schon mit dem (Un)Sinn von Wertungssystemen (siehe ->Teil 1 – Feuilleton gegen Stiftung Warentest).
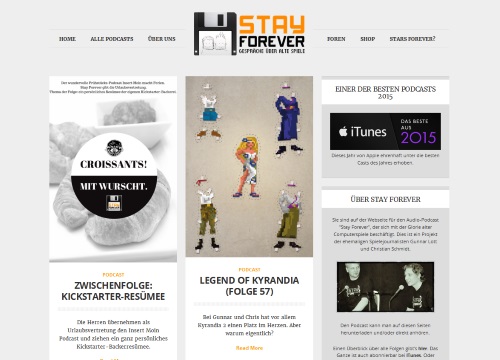
Zugegeben, die Grenzen zu etablierten Medienformen sind da fließend: So finden sich zum Beispiel neben den reinen Podcasts auch klassische Radiobeiträge, die via Web gehört werden können. ->Tobias Nowak zum Beispiel arbeitet mit seiner Firma ->Radiobühne unter Anderem für den WDR die kulturelle Relevanz digitaler Spiele heraus. Für den österreichischen Sender ->fm4.orf.at produziert ->Robert Glashüttner mit vergleichbarem Anspruch. Es ist schwer zu beurteilen, welche Reichweite diese Angebote haben. Mein Eindruck ist jedoch, dass Radioangebote weniger angenommen werden, zumal öffentlich-rechtliche Beiträge in der BRD depubliziert werden müssen. Das bedeutet, im Gegensatz zu den Podcasts stehen sie oft nur wenige Wochen zur Verfügung, weil sich die Privatsender vor der gebührenfinanzierten Konkurrenz fürchten. Das ist deswegen eine besonders perfide Frechheit, weil die meist seichten, gemainstreamten Privatprogramme nicht einmal planen, vergleichbare Inhalte überhaupt anzubieten.
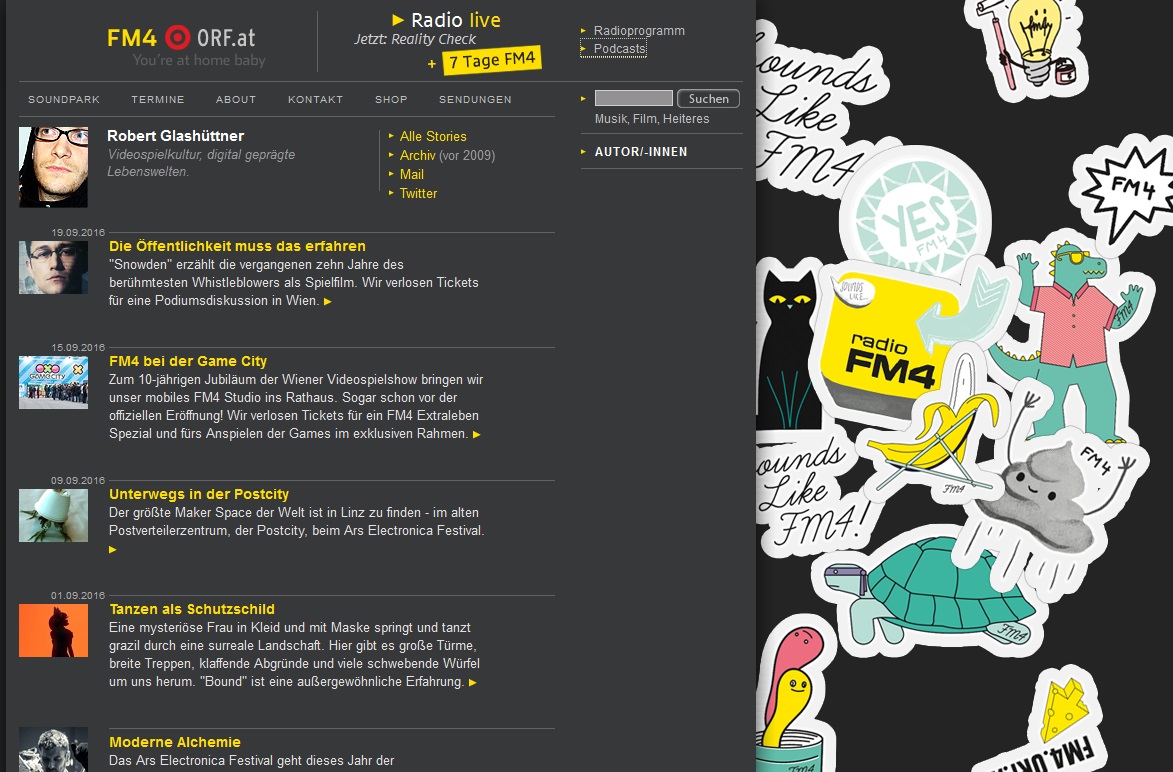
Die Menge an Informationen jedenfalls, die man an diesen und an vielen anderen Stellen im Netz erhält, ist im Verhältnis zu früher enorm. Dass jetzt so viel Wissen dezentral aufgerufen werden kann, überfordert auch, weil ein Überblick über die Angebote schwer zu gewinnen ist. Die großartige Vielfalt aber liegt vor allem daran, dass technische Schwellen für mediale Äußerungen von Individuen heutzutage kaum noch existieren. Um finanziell einen Anschub zu erhalten, können die Macher solcher Angebote sogar um Unterstützung auf Plattformen wie ->Patreon oder ->Flattr bitten.
Das geballte Wissen der genannten Personen wäre noch vor einem Jahrzehnt im Schlund des nichtmedialen Raumes versunken. Heute können sie sich alle äußern, ohne dafür gleich auf ein eigenes Magazin angewiesen zu sein – eine kaum zu überschätzende kulturelle Errungenschaft, wie ich finde. Da ist es zu verschmerzen, wenn man von den zahlreichen Angeboten nicht alle kennt oder nicht alle Inhalte zu konsumieren schafft. Vor Kurzem hätte es sie alle nicht gegeben.
Visualisierung
Was allerdings fehlt, ist eine effiziente Möglichkeit, diese Angebote besser im Web zu sortieren und zu kanalisieren, um sie besser zu finden und die Spreu vom Weizen zu trennen. Qualitativ ordentliche journalistische Arbeit zu finden, funktioniert hier häufig nur über soziale Netzwerke. Abgesehen von besseren Webverzeichnissen, am Besten automatisch etwa durch Meta-Crawler aktualisiert, müsste in Werkzeuge zur Bewältigung dieser Flut im Netz deutlich mehr Grips investiert werden. Wäre das nicht mal eine interessante Aufgabe für ein Fraunhofer-Institut oder die technischen und angewandten Hochschulen? Vielleicht müssten Suchmaschinen solche Netzwerke eher räumlich visualisieren, damit man einen sinnvollen Überblick gewinnen kann. Da hat mich bislang noch keine Lösung überzeugen können.
Visualisierung ist jedoch eine gute Überleitung dazu, was eine große Herausforderung für den Printsektor, grundsätzlich aber für alle textbasierten Angebote darstellt. Seit Jahren boomen Plattformen für Video-On-Demand oder Streaming, die das Bewegtbild als Allheilmittel propagieren. Dass textliche Formate oder Audioangebote auch ihren Stellenwert haben, wenn man sich deren mediale Eigenschaften genauer ansieht und zielgerichtet für geeignete Zwecke verwendet, wird dort häufig nicht reflektiert. Die dortigen Formate, die Spiele betreffen, haben zudem häufig Urheber, die gänzlich anders für ihre Tätigkeit sozialisiert wurden als über den klassischen Journalismus zu digitalen Spielen.
Der folgende Teil wird daher diskutieren, wie die Youtubisierung auf das spielekulturelle Spektrum wirkt und welche Chancen sich für Videokanäle ergeben – bis hin zur Enstehung von ganztägigen Fernsehformaten an herkömmlichen TV-Institutionen vorbei.
weiter zu Teil 5 – Die Youtubisierung des Abendlandes
3 Gedanken zu „KOMMENTAR: Gibt’s das auch als Film? (Teil 4)“